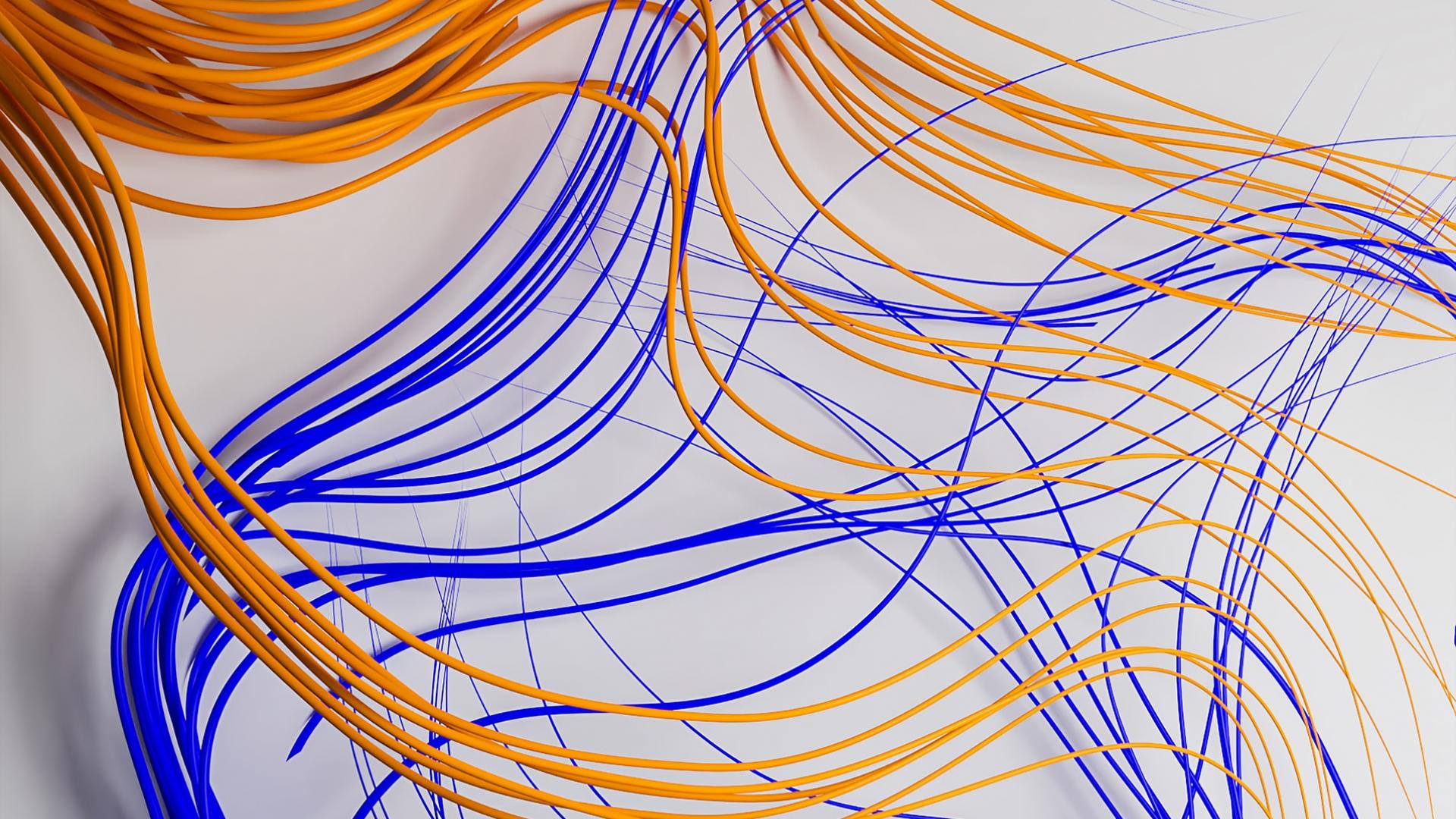
Gastautor Nicolas Zahn betrachtet die Art und Weise, wie die Mechanismen des Föderalismus im Digitalisierungsprozess spielen, genauer. Die beiden herkömmlichen Vorteile des Föderalismus, der Anreiz zur Abgrenzung und das Experimentieren mit möglichen Lösungen und deren Skalierung, greifen bei der Digitalisierung nicht mehr. Ist es Zeit, die “heilige Kuh” des Schweizer Politik- und Verwaltungssystems zu opfern?
Der Föderalismus gehört zu den zentralen Elementen der schweizerischen Staatsorganisation. Diese zentrale Stellung verdankt das Konzept seinen vielen Vorteilen, von der Entgegenwirkung von Machtkonzentrationen und dem entsprechenden Potential des Machtmissbrauchs hin zum Argument, dass der Wettbewerb verschiedener Standorte sich positiv auswirke. Dies war auch der Grund, weshalb ich in einem früheren Text dem Föderalismus in Bezug auf seine Wirkung auf die Digitalisierung der Schweizer Behörden Vor- und Nachteile zugestand. Doch mittlerweile überzeugt mich das Argument des Wettbewerbs als Vorteil nicht mehr.
Ich stelle nicht die Vorteile von Wettbewerb per se in Abrede. Aber in Hinblick auf die Frage der Auswirkungen des föderalen Systems auf die digitale Transformation der Schweizer Behörden gilt es festzuhalten, dass konstruktiver Wettbewerb auf Annahmen basiert. Annahmen, die ich für die Digitalisierung nicht als erfüllt betrachte. Ausserdem wird Wettbewerb gerne als Totschlagargument verwendet gegenüber Forderungen nach gewissen Mindeststandards für die Digitalisierung. Schliesslich möchte man den wichtigen und konstruktiven Wettbewerb nicht unnötig durch Regeln behindern. Somit wandelt sich der theoretische Vorteil des föderalen Wettbewerbs zu einer faktischen Fortschrittsbremse und einem Nachteil für die überfällige Digitalisierung der Schweizer Behörden.
Die erste Annahme, welche mit Wettbewerb in Verbindung gebracht wird, ist, dass die am Wettbewerb Teilnehmende – hier die Kantone – Anreize haben, sich gegenüber den anderen abzugrenzen. Diese Differenzierung spielt z.B. beim Steuerwettbewerb. Naturgemäss macht eine solche Differenzierung und damit ein Wettbewerb nur Sinn, wenn man sich wirklich differenzieren kann. Doch in der Schweiz brüstet sich kein Kanton damit, besonders digital fortschrittlich zu sein. Lieber setzt man andere Aspekte in den Vordergrund, evtl. weil die Qualität der analogen Verwaltungsdienstleistungen bereits gut und die Interaktionen überschaubar sind. Die Nachfrage nach fähigen digitalen Behörden von Seiten der Bevölkerung aber auch von Seite juristischer Personen dürfte in Zukunft jedoch zunehmen. Zu grosse Differenzen werden zumindest bei der Digitalisierung jedoch nicht geschätzt und sind auch nicht sinnvoll, Stichwort Interoperabilität. So ergab auch eine aktuelle Umfrage, dass sich Bürgerinnen und Bürger nicht nur mehr, sondern auch einheitliche digitale Behördendienstleistungen wünschen.
Der föderale Wettbewerb, so eine weitere Annahme, erlaubt das Experimentieren mit möglichen Lösungen und, sollte sich die Lösung beweisen, die spätere Skalierung auf die Schweiz. Ein Beispiel aus der digitalen Verwaltung ist eUmzug: zuerst in einem Kanton entwickelt und erprobt, dann skaliert auf andere Kantone.
Doch abgesehen davon, dass die Liste solcher „Erfolgsstorys“ überschaubar bleibt, gibt es drei Probleme mit dieser Annahme.
Erstens braucht es im jeweiligen Kanton überhaupt den politischen Willen, sich auf ein digitales Experiment einzulassen und vorzupreschen. Nach zahlreichen negativen Erfahrungen mit Digitalisierungsprojekten scheinen die Kantone eher in der Defensive. Es herrscht das Gefühl, dass man wenig Gewinnen aber einiges von Steuergeld bis zum Ruf verlieren könne. Hier wird es interessant sein zu sehen, welche nachhaltigen Auswirkungen Corona haben wird.
Zweitens, selbst wenn man sich auf das Experimentieren einlässt, so kommt dies mit gewissen Ineffizienzen. Ist es wirklich ratsam, dass in mehreren Kantonen an einer digitalen Lösung für das gleiche Problem gearbeitet wird? Muss das Rad jeweils neu erfunden werden? Zielführender wäre wohl eher ein verbesserter Informationsaustausch und koordinierte Zusammenarbeit.
Dies führt uns zum dritten Problem: der Skalierung von Lösungen, welche in der Theorie wunderbar klingt, aber in der Praxis an politischen Grabenkämpfen, Gärtchendenken und inkompatiblen Systemen sowie fehlenden Datenmodellen scheitert. Will man wirklich die Lösung „der Anderen“ übernehmen oder lieber selbst etwas entwickeln?
Das Konkurrenzdenken sowie fehlende Koordination und Kooperation machen den Föderalismus in der Digitalisierung zum Bremsklotz. Es muss die Erkenntnis reifen: um bei der Digitalisierung endlich vorwärtszumachen, braucht es ein Ökosystem mit verbindlichen Mindeststandards, die für alle gelten. Diese Stossrichtung verfolgt auch das EMBag und die neue Organisation Digitale Verwaltung Schweiz, jedoch besteht weiterhin Handlungsbedarf, denn erstens gibt es geringe Ambitionen von Seiten Bund, um sich nicht unbeliebt zu machen bei Kantonen sowie zweitens eine negative Vernehmlassungsantwort der Kantone, welche die „heilige Kuh“ Föderalismus über sinnvolle Mindeststandards stellt.
In der digitalen Welt sind Standards und Interoperabilität zentral. Aufbauend auf dieser Infrastruktur – die harmonisiert sein muss – können die Kantone dann noch so gerne Wettbewerb betreiben, um sich nach oben abzuheben. Aktuell drohen wir aber einfach auf zu tiefem Niveau zu verharren.
Nicolas Zahn hat in Zürich, Genf und Washington DC Politik und Internationale Beziehungen studiert. Nach dem Mercator Kolleg für Internationale Aufgaben mit Fokus auf die digitale Transformation des öffentlichen Sektors arbeitete er als Digital Consultant bei ELCA Informatik und nun als Senior Project Manager bei der Swiss Digital Initiative.