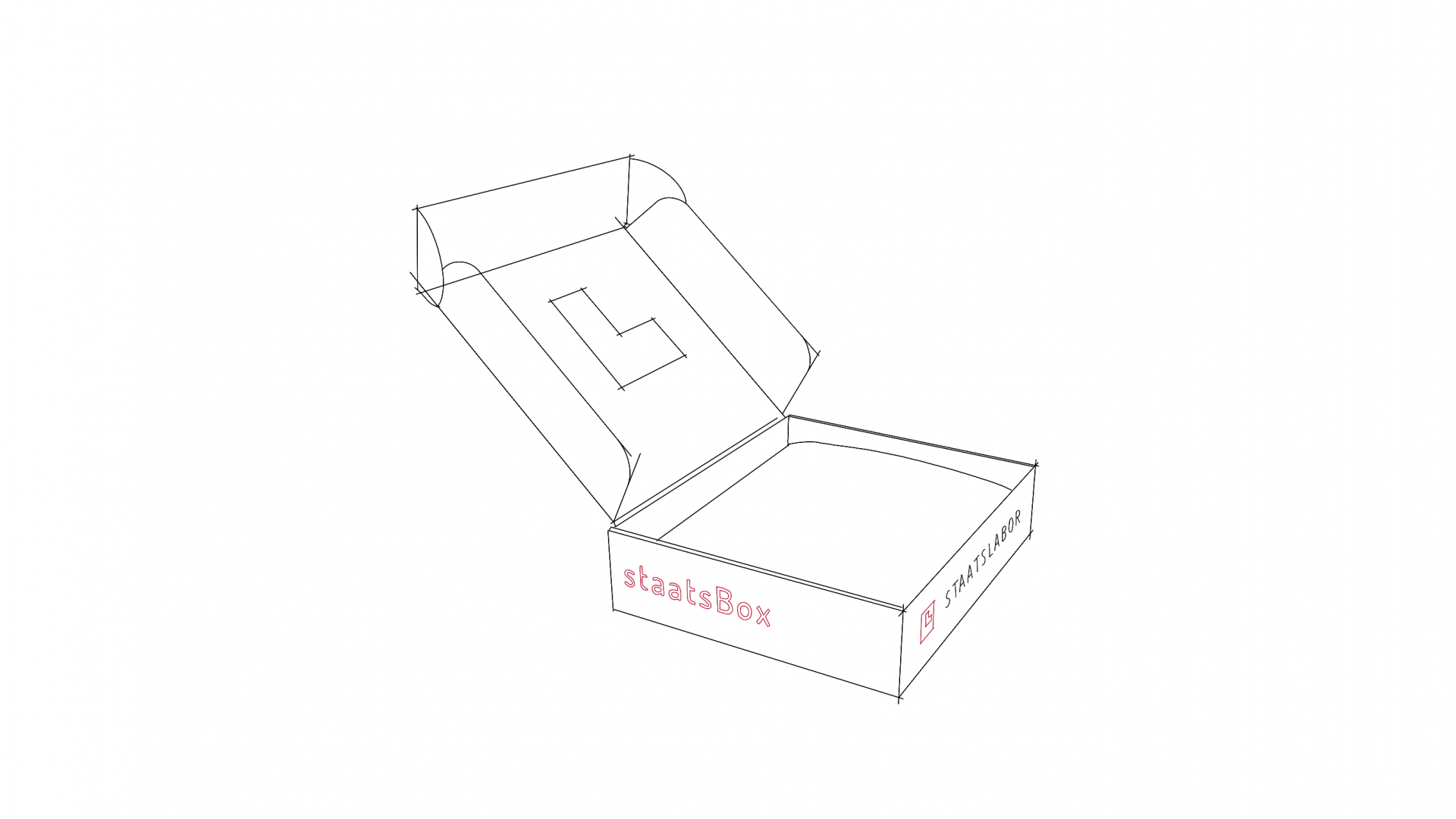
Zusammen mit MitstreiterInnen aus dem öffentlichen Sektor entwickelt das staatslabor eine Innovationsbox, die ganz auf die Herausforderungen in der Verwaltung zugeschnitten sein soll. Wir haben sie staatsBox getauft. Nach gut drei Monaten des gemeinsamen Tüftelns und Testens ist es Zeit für einen ersten Bericht aus dem Labor. Was haben wir bisher gelernt? Was war spannend, überraschend, erhellend?
"Ich freue mich, dass ich an diesem Experiment teilnehmen kann", sagt Sabina Helfer. Die Kommunikationsexpertin aus dem Bundesamt für Gesundheit ist seit April 2019 Teil der staatsBox-Pilotgruppe. Die Pilotgruppe unterstützt das staatslabor dabei, neue Innovationswerkzeuge für den öffentlichen Dienst zu entwerfen und zu erproben.
Mit Gleichgesinnten aus ganz verschiedenen Bereichen der öffentlichen Verwaltung - etwa dem Bundesamt für Verkehr, der Konferenz der Kantonalen Justiz- und PolizeidirektorInnen oder der Integrierten Psychiatrie Winterthur - unterstützt uns Sabina dabei, eine Service Public Innovationsbox zu entwickeln: Die staatsBox.
Warum braucht es eine staatsBox?
Die staatsBox führt ihre NutzerInnen Schritt für Schritt durch einen Ideen-Entwicklungsprozess und hilft dabei, auf strukturierte Art und Weise neue Lösungsansätze zu erproben. Sie schafft Raum zum Tüfteln und soll inspirieren. Gleichzeitig verlangt sie von ihren NutzerInnen die Bereitschaft, die Probleme, die sie angehen möchten, einer rigorosen Analyse zu unterziehen.
Im öffentlichen wie auch im Privatsektor sollen Innovationsboxen dabei helfen, die Kreativität der MitarbeiterInnen abzuholen. In jeder grossen Organisation schlummert auf allen Hierarchiestufen viel Wissen - oft im Tiefschlaf. Lukas Huber, stellvertretender Generalsekretär des Obergerichts Zürich und Mitstreiter in der Pilotgruppe konstatiert denn auch: "Die Innovationskraft der Mitarbeitenden im öffentlichen Sektor wird nach wie vor viel zu wenig genutzt. Wir können es uns nicht leisten, dieses Potential auch künftig brach liegen zu lassen."
Wie können wir nun diese kollektive, dezentrale Intelligenz abholen? In der Regel reichen weder Top-Down Ansagen ("Seid kreativ. Jetzt!") noch abstrakte Innovationsschulungen. Es braucht praktische Hilfestellungen und Räume, in denen an Problemen getüftelt und Konzepte erprobt werden können. Und ganz wichtig: es braucht den Raum und die Bereitschaft zum Scheitern.
Genau dafür ist die staatsBox da. Mit ihr sollen die VerwaltungsmitarbeiterInnen befähigt werden, eigene Ideen zu schärfen und zur Umsetzungsreife zu bringen. Gleichzeitig soll die staatsBox ein sichtbares Zeichen sein, dass der öffentliche Sektor für kreative und unternehmerische Köpfe ein attraktiver Arbeitsort ist.
Was muss die staatsBox für Verwaltungen leisten?
Innovationsboxen sind in grossen Privatunternehmen seit mehreren Jahren im Einsatz und wohl erprobt. Eine speziell auf den öffentlichen Dienst zugeschnittene Box gibt es aber noch nicht. So haben wir in der Pilotgruppe die Frage diskutiert, welchen spezifischen Realitäten wir Rechnung tragen müssen, wenn wir die Box in die Verwaltung übertragen wollen.
Beginnen wir bei den formalen Unterschieden. Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen bewegen sich die meisten Staatseinheiten in einem engen regulatorischen Korsett. Ihre Aktivitäten sind durch gesetzliche Leistungsaufträge gebunden. Sie können nicht einfach neue Angebote erschaffen. Und oft fehlt ihnen das direkte Feedback von NutzerInnen oder BürgerInnen.
Öffentliche Unternehmen sind etwas weniger eingeschränkt. Doch sie sind oft in Märkten tätig, die straff reguliert sind - so etwa im Energie-, Transport- und Gesundheitssektor - und können nicht schalten und walten, wie es ihnen gefällt. Innovation im öffentlichen Sektor fokussiert demnach zu einem grossen Teil darauf, ihren Leistungsauftrag so bürgernah, speditiv und elegant wie möglich zu erfüllen.
In den Diskussionen unserer Pilotgruppe hat sich zudem gezeigt, dass es vor allem an einem fehlt: am Raum für offenen Austausch und niederschwelliges Tüfteln. So werden innovative Ansätze oft unterbunden. Die Kompromiss- und Konsenskultur des Schweizer Staatswesens gehört zu einer Staatsräson, die im Zweifelsfall eine langsame, aber sorgfältige und vor allem möglichst fehlerfreie Lösung bevorzugt. Die Bereitschaft, Experimente einzugehen, ist dabei beschränkt. Zu gross ist die Angst, im Falle des Scheiterns in den Fokus der Presse zu geraten oder sich als Objekt politischer Grabenkämpfe wiederzufinden.
Wie wird die staatsBox entwickelt?
Um die staatsBox den Realitäten des öffentlichen Sektors anzupassen, entwickeln wir sie nun also gemeinsam mit StaatsmitarbeiterInnen. Sie kennen die Herausforderungen ihrer Arbeit am besten. Sie sind die ExpertInnen dafür, welche Werkzeuge in der Praxis funktionieren könnten und welche nicht. Und sie sind schliesslich auch die zukünftigen NutzerInnen der Box.
Das Prototyping der staatsBox lebt in diesem Sinn einen nutzerzentrierten Esprit vor, der die staatsBox bald in möglichst viele Verwaltungseinheiten tragen soll. Nach einer breiten Ausschreibung und einigen Telefonaten bildete sich am Kick-Off Abend im April eine staatsBox-Pilotgruppe, die seither an Workshop-Abenden zusammenkommt und dazwischen mit Hilfe des staatsBox-Prototypen eigene Ideen verfeinert.
Dabei verfolgen wir ein doppeltes Ziel. Wir begleiten die Mitglieder der Pilotgruppe bei der Entwicklung ihrer konkreten Ideen. Gleichzeitig inspiriert die Pilotgruppe mit ihrem Feedback die Ausgestaltung des ersten staatsBox Prototypen.
Und nun zurück zur Einstiegsfrage. Was haben wir bisher gelernt?
Was sind bisher unsere drei wichtigsten Erkenntnisse?
Erstens: Die Einbettung in die Hierarchie ist zentral.
Bottom-up Innovation, die aus der Motivation der einzelnen MitarbeiterInnen fliessen soll, kann nur erfolgreich sein, wenn die zuständige Hierarchie ihren Support glasklar und für alle sichtbar kommuniziert. Nichts tötet Innovation effektiver als eine lediglich lauwarme Unterstützung von Vorgesetzten, die sich in Luft auflöst, wenn es darum geht, die Umsetzung der erarbeiteten Ideen ernsthaft zu prüfen. Lukas Huber vom Zürcher Obergericht bestätigt das: "Für eine wirklich innovative Verwaltung brauchen die Mitarbeitenden aber nicht nur einen effektiven Werkzeugkasten, sondern auch das Vertrauen ihrer Vorgesetzten und die nötigen Ressourcen, um möglichst frei an ihren Innovationen basteln zu können. Hier besteht noch grosser Handlungsbedarf."
Abteilungs-, Amts- und Departementsleitungen müssen sich bewusst dafür entscheiden, ihren MitarbeiterInnen mit einer Innovationsbox Freiraum zu geben. Um gute Ideen entwickeln zu können, brauchen die TüftlerInnen erstens ein explizit dafür reserviertes Zeitbudget und zweitens die Möglichkeit, KollegInnen auf anderen Hierarchiestufen möglichst frei begegnen zu können. Ideenentwicklungsprozesse sind stets resultatoffen und entziehen sich in der Folge teilweise der Kontrolle der Hierarchie. Das ist nicht nur gewünscht, sondern unumgänglich.
Zweitens: Politische Visionen sind erwünscht.
Viele ambitionierte Innovationsideen beinhalten die Verbesserung der Zusammenarbeit verschiedener öffentlicher Institutionen. Solche Innovationsprozesse sind oft zähflüssig, da die Optimierung der Gesamtprozesse zwar meist BürgerInnen oder NutzerInnen zu Gute käme, aber nicht zwingend im Interesse der einzelnen Ämter oder Departemente ist. In solchen Konstellationen ist eine auf hoher politischer Ebene verankerte Innovationsvision von grossem Vorteil. Denn sie kann allen Institutionen signalisieren, dass Veränderung eben gewünscht ist.
Drittens: Gemeinsam kommt man am weitesten.
Will man das Wissen und die Kreativität der Mitarbeitenden auf allen Hierarchiestufen abholen, sollte der Ideen-Entwicklungsprozess als Ganzes Spass machen. Kreativität ist ohne Freude nicht zu haben. In diesem Sinne versteht sich die staatsBox auch als Spielwiese. Und es hat sich gezeigt: am meisten Spass macht es meist, wenn man nicht alleine innoviert. Kann man gemeinsam Hypothesen aufstellen, diese erkunden, verwerfen, um dann wieder neue Ideen erproben, ist dies oft elektrisierend. Dann entsteht wirklich Raum für Neues. So kommen wir weiter.